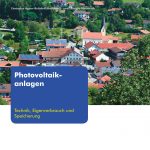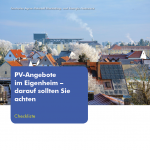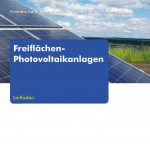Die freie Verfügbarkeit von Sonnenenergie, die Langlebigkeit der Module, der wartungsarme und emissionsfreien Betrieb sowie die gefallenen Anlagenkosten haben die Photovoltaik (PV) zu einer der wichtigsten Erzeugungsformen von erneuerbarem Strom gemacht. Im Regelfall hat hierzulande eine PV-Modul nach etwa ein bis zwei Jahren mehr Energie erzeugt, als für dessen Herstellung aufgewendet werden musste. Kein Wunder also, dass die Photovoltaik als Kraftwerksform nicht nur in großen Dimensionen wie z. B. bei Freiflächenanlagen existiert, sondern sich im kleinen Maßstab auch für Privatpersonen als Möglichkeit zur Eigenstromerzeugung durchgesetzt hat. Um die Klimaschutzziele in Deutschland zu erreichen und den zunehmenden Strombedarf in den Sektoren Wärme und Mobilität aus Erneuerbaren Energien zu decken, ist dennoch auch zukünftig ein deutlicher Ausbau der solaren Erzeugungskapazitäten erforderlich.
Unsere Themen
Aktuelles
- Beteiligung an Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen
- Antragstellung zum „Bundesprogramm Energieeffizienz” unter anderem für PV, Wärmepumpe und Speicher ab sofort wieder möglich
- Photovoltaik-Angebote für Ihr Eigenheim: Broschüre bietet umfassende Checkliste für Hausbesitzer
- Erneuerbare Energien in der Landwirtschaft – der LandSchafftEnergie-Themenmonat im November 2025
- Photovoltaik auf Freiflächen: Broschüre bietet praxisnahe Fakten zu Planung, Bau und Betrieb
- Effizient kombiniert: Broschüre zu Wärmepumpe und Photovoltaik
Unsere Veranstaltungen zum Thema Photovoltaik
C.A.R.M.E.N.-WebSeminar „Photovoltaik auf dem Eigenheim“
C.A.R.M.E.N.-OnlineFAQ
Photovoltaik – allgemein
Steckerfertige Solaranlagen
Publikationen
Photovoltaik in Kommunen

Kommunale Gebäude bieten oft große Potenziale für die Installation von Photovoltaik. Informieren Sie sich auf unserer Wissensplattform Energiewende vor Ort: Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden über die Planung, die Umsetzung und den Betrieb kommunaler PV-Anlagen.
Förderungen
Unser Beratungsangebot
Wir beraten und informieren Sie gerne rund um das Thema Photovoltaik – online, telefonisch oder persönlich vor Ort!
Hier finden Sie unsere C.A.R.M.E.N.-Expertinnen und Experten in diesem Bereich: